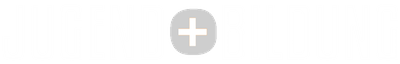Motivieren statt sanktionieren: Müllvermeidung durch Nudging?
Unterrichtseinheit
5,99 €
Diese Unterrichtseinheit befasst sich mit der Methode des Nudgings, mit der das Verhalten von Menschen durch "anstupsen" (anstelle von Verboten, Geboten oder ökonomischen Anreizen) beeinflusst werden soll. Die Einheit präsentiert und hinterfragt diesen Ansatz der Verhaltensökonomie in mehreren Lernrunden für den Bereich der Umweltpolitik mit Schwerpunkt Verpackungsmüll.Wie kann man Menschen dazu bewegen, etwas Gutes zu tun? Trotz zahlreichen Aufklärungen und Mahnungen kaufen die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher nach wie vor Billigfleisch im Supermarkt und eben nicht Bio-Fleisch beim "Metzger ihres Vertrauens". Trotz zahlreicher Aufklärungskampagnen bringen die meisten Konsumentinnen und Konsumenten noch immer keine Tasche mit, sondern lassen sich an der Supermarkt-Kasse eine Plastiktüte aushändigen. Wer verwendet schon Mehrwegbecher für Kaffee oder achtet beim Shoppen darauf, ob ein Kleidungsstück nachhaltig produziert wurde? Die meisten Menschen sind für den Umweltschutz, die wenigsten handeln aber danach. Wie bringt man also Menschen dazu, sich umweltverträglich zu verhalten? Durch Gebote und Verbote, durch höhere Strafen, durch Subventionen von Bio-Produkten? Eine verhaltensökonomische Methode namens "Nudging" (englisch für "Stups" oder "Schubs") will die Menschen durch kleine Impulse dazu bringen, sich an ihre eigenen Aussagen zu erinnern, sie vor Fehlverhalten warnen, ihnen positive Verhaltensweisen zu erleichtern und sie auf negative Folgen ihrer Handlungen oder Entscheidungen hinweisen. Die Impulse können im einfachsten Fall ein farbiger Strich auf dem Boden, eine andere Farbgebung für bestimmte Parkplätze, ein greller Ton, ein Warnhinweis oder eine gezielte Information sein. Die Unterrichtseinheit "Motivieren statt sanktionieren: Müllvermeidung durch Nudging?" thematisiert und hinterfragt diesen Ansatz der Verhaltensökonomie in mehreren Lernrunden für den Bereich der Umweltpolitik mit Schwerpunkt Verpackungsmüll. Thematischer Hintergrund: Verhaltensökonomie und Nudging "Nudging", das sanfte Anstupsen von Menschen, erschien in den letzten Jahren vielen Regierungen, Politikerinnen und Politikern als neue Wunderwaffe gegen Politik- und Demokratieverdrossenheit: keine Zwangsmaßnahmen mehr, kein Unmut der Bürgerinnen und Bürger über forderndes Regierungshandeln, statt dessen zarte Impulse, die die Menschen zu Verhaltensänderungen bewegen, die sie selbst möchten. Der "böse Staat" wird zum fürsorglichen Partner, der seine Bürgerinnen und Bürger im Daseinskampf begleitet… Der Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler und der Rechtswissenschaftler Cass Sunstein haben hierfür den Begriff "libertärer Paternalismus" geprägt. Er will zwei Prinzipien vereinen: Die Bürgerinnen und Bürger sollen nach wie vor frei in ihrem Handeln sein, allerdings unter der schützenden Hand eines staatlichen Vormunds. Aus Sicht der Regierenden ist dieser Ansatz, zudem noch wissenschaftlich begründet, äußerst reizvoll. Die alte staatliche Bevormundung kommt im neuen Gewand der Freiwilligkeit daher. Der Staat gibt bei seinem Versuch, das menschliche Verhalten lenken zu wollen, das Versprechen ab, dieses Mal viel "humaner" vorzugehen. Der Öffentlichkeit wird damit suggeriert, staatliches Handeln sei mit libertären Ideen vereinbar. Gleichzeitig wird den staatlichen Regelungen ein positives Image verliehen. Für Cass Sunstein handelt es sich bei Nudging daher um einen völlig neuen politischen Ansatz, bei dem der Staat in letzter Konsequenz seine Ziele auch ohne Gesetze und Verordnungen erreichen kann. Kritiker wenden demgegenüber ein, dass Nudging letztlich nichts anderes als den Versuch einer Manipulation beinhalten würde. Die Bürgerinnen und Bürger sollen veranlasst werden, genau so zu handeln, wie der Staat dies möchte. Dass es sich in vielen Fällen dabei um positive, wünschenswerte und sinnvolle Zielsetzungen (zum Beispiel mehr Umweltschutz) handelt, sei dabei zweitrangig. Die Unterrichtseinheit "Motivieren statt sanktionieren: Müllvermeidung durch Nudging?" möchte den Schülerinnen und Schülern die Idee des Nudging näher bringen. Hierzu erarbeiten sie konkrete und praktische Lösungsansätze zur Vermeidung von Plastikverpackungen und Plastikbeuteln und stellen diese zur Diskussion. Gleichzeitig können sie dabei deutlich machen, wo die Grenzen und Risiken von Nudging liegen. Intention der Unterrichtseinheit Die Menschheit ist gerade dabei, ihren Heimatplaneten Erde schwerwiegend zu schädigen. Dies geschieht auf vielfältige Weise, in nicht geringem Umfang auch durch Verpackungsabfälle, vor allem aus Plastik. Schon heute schwimmen in den Weltmeeren mehrere riesige Plastikstrudel. Nicht nur die Meere, sondern auch das Trinkwasser sind bereits durch Mikroplastik verunreinigt. Dies tötet nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern birgt auch enorme gesundheitliche Risiken für den Menschen selbst. Da es nach Aussagen aller ernstzunehmenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei diesem Selbstzerstörungsprozess der Menschheit bereits "5 nach 12" ist, gilt es die Menschen nicht nur aufzurütteln, sondern endlich zu praktischem Handeln anzuleiten. Dazu aber sind konkrete Vorstellungen und Konzepte und notwendig. Soll man Mitmenschen, die einen Plastikbecher auf die Straße werfen, bestrafen? Wenn ja, wie? Soll man die Plastikbecher so verteuern, dass sie am Ende gar unerschwinglich werden? Oder soll der Staat andere Methoden versuchen, um die Bürgerinnen und Bürger zu umweltverträglichem Verhalten zu zwingen. Nudging könnten einen sozialverträglichen Beitrag dazu leisten. Eigenverantwortliches Arbeiten und Methodenvielfalt Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es, die Verwendungsmöglichkeit von Nudging-Methoden für die Bereiche Umweltschutz im weiteren und Verpackungsvermeidung im engeren Sinne zu durchdenken und Vorschläge für den Alltag zu entwickeln. Die fünf Lernrunden reichen von Bildinterpretationen über Internet-Recherchen, Tabellen- und Textinterpretationen bis hin zu Präsentationen, Abstimmungen und einer Meinungsbildung mittels der Dissonanzmethode. Fachkompetenz Die Schülerinnen und Schüler erklären Richard Thalers Nudging-Theorie. entwickeln Nudging-Konzepte für Müllprobleme. bilden sich eine Meinung zu Nudging als politischer Steuerungsmethode und können diese im öffentlichen Raum vertreten. Medienkompetenz Die Schülerinnen und Schüler recherchieren zielgerichtet im Netz. rufen Videoclips im Netz auf, analysieren und bewerten sie. visualisieren eigene Präsentationen und bereiten Abstimmungsergebnisse grafisch auf. Sozialkompetenz Die Schülerinnen und Schüler werten in einer Gruppe zielgerichtet Informationen aus, bereiten diese auf und entwickeln daraus eigene Konzepte für Praxis-Probleme. bereiten diese Praxis-Probleme für eine Präsentation auf und visualisieren sie. präsentieren adressatenadäquat im Team adressatenadäquat. behaupten sich in unterschiedlichen Kommunikationssituationen und bringen sich konstruktiv in die Gruppenarbeit ein.
-
Wirtschaft
-
Berufliche Bildung,
Sekundarstufe II