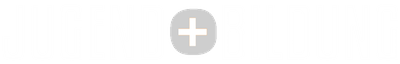Kirche, Pop und Sozialismus – Die Rolle der Kirchen in der DDR
…
Kopiervorlage
Das Unterrichtsmaterial zum Film "Im Namen des Herrn" thematisiert die Rolle der Kirchen in der DDR und die Symbiose zwischen Kirche, Musik und Systemkritik.Die Kirche in der DDR war ein Ort, der verfassungsrechtlich geschützt war, aber zugleich immer im Visier des SED-Regimes stand. In vielen Kirchen fanden kritische Stimmen und Andersdenkende einen Schutzraum. Musik war dabei ein wichtiges Bindeglied und Ausdrucksmittel: Bluesmessen, Liedermacher und Punkkonzerte lockten viele Besucherinnen und Besucher an und schufen eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Diese Allianz von Musik, Kirche und Systemkritik veranlasste das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) dazu, an Zersetzungsstrategien zu arbeiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchen zu platzieren. Der Film "Im Namen des Herrn - Kirche, Pop und Sozialismus" zeichnet die Symbiose von Kirche, Popmusik und Opposition nach und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen. Die DVD kann für 5 Euro bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erworben werden. Durch das begleitende Unterrichtsmaterial lernen die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Zeitzeugeninterviews und setzen sich mit der besonderen Rolle der Kirche und der Musik in der DDR auseinander. Dabei sollen sie erfahren, dass viele Menschen auch in Diktaturen versuchten, Freiräume zu finden und zu nutzen, dass aber zugleich die SED-Diktatur immer bemüht war, in diese Freiräume einzudringen und sie zu kontrollieren. Diese Unterrichtsmaterialien wurden erstellt von paedigi. Sachkompetenz Die Schülerinnen und Schüler charakterisieren die verfassungsrechtliche Lage der Kirchen in der DDR. erklären, warum die Kirche in der DDR eine wichtige Rolle für Musikerinnen und Musiker und Oppositionelle einnahm. nennen wichtige Akteure aus den Kirchen der DDR. nennen wichtige systemkritische Musikerinnen und Musiker aus der DDR. nennen zentrale Merkmale des Verhältnisses von DDR-Staat und Kirche. Methodenkompetenz Die Schülerinnen und Schüler erschließen gezielt Informationen über die Rolle der Kirchen in der DDR und ihr Verhältnis zum Staat aus dem Film. erschließen Einstellungen und Argumente sowohl von Pfarrern als auch Musikerinnen und Musikern in der DDR mithilfe von Zeitzeugeninterviews. recherchieren in verschiedenen Medien nach weiterführenden Informationen zu verschiedenen Inhalten des Films. konzipieren eine Ausstellung zum Thema Jugend- und Musikkulturen in der DDR. analysieren Liedtexte von systemkritischen Musikerinnen und Musikern aus der DDR. Urteilskompetenz Die Schülerinnen und Schüler bewerten die im Film geäußerten Meinungen der Zeitzeugen, erkennen ihre Subjektivität und gehen kritisch mit den verschiedenen Perspektiven um. nehmen Stellung zum unterschiedlichen Umgang von Musikerinnern und Musikern mit dem DDR-Staat. diskutieren, ob unterschiedliche politische System eine Rolle bei der Entwicklung verschiedener Musikrichtungen wie z.B. Punk spielten.
-
Geschichte
-
Sekundarstufe II