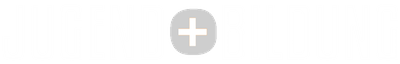Leselust fördern: Schülerinnen und Schüler zum (eigenständigen) Lesen…
Fachartikel
1,99 €
In diesem Fachartikel zum Thema Leseförderung geht es darum, wie Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler unterstützen können, die wenig oder ungern lesen. Ziel dabei ist es, die Kinder und Jugendlichen so zu motivieren und zu unterstützen, dass sie auch außerhalb des Unterrichts lesen, zum Beispiel als Hausaufgabe.Kinder und Jugendliche, die zu Hause nicht oder wenig beim Lernen und Lesen unterstützt werden, haben es bei Schulschließungen und Online-Unterricht besonders schwer. In Bezug auf die Lesekompetenzen kann das bedeuten, dass sich diese weniger schnell entwickeln als die von Mitschülerinnen und Mitschüler, die von den Eltern stärker gefördert werden. Dabei macht gerade beim Lesen die Übung den Meister. Doch wie lassen sich Schülerinnen und Schüler motivieren, selbstständig zu Hause zu lesen? Lesestoff auswählen Je nachdem, ob Sie im Deutsch-Unterricht eine gemeinsame Lektüre lesen, im Fach-Unterricht Sachtexte bearbeiten oder in der Fördergruppe individuelle Leseförderung anbieten: Am Anfang stellt sich die Frage nach der Auswahl des Lesestoffs. Für Kinder und Jugendliche, die nicht viel oder nicht gern lesen, bietet die Stiftung Lesen eine Materialdatenbank an. Die empfohlenen Medien lassen sich nach Alter und Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen sowie nach Medienkategorie und Thema filtern: https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/lese-und-medienempfehlungen#suche Für jüngere Kinder ist die Stoffauswahl etwas weniger schwierig: Die Geschichte muss spannend sein und der Altersgruppe entsprechen. Doch die stärkste Motivation ziehen kleinere Kinder aus dem Vorlesen, dem gemeinsamen Lesen und so weiter, also aus der sozialen Einbettung der Lesesituation. Für leseungewohnte Jugendliche kann die Stoffauswahl schwieriger sein. Ihre Erfahrungswelt und ihre Interessen entsprechen ihrem Alter, die Lesekompetenz hingegen einer niedrigeren Klassenstufe. Kinderbücher sind für diese Gruppe sehr demotivierend: Sie unterfordern die Jugendlichen inhaltlich und spiegeln ihnen durch Themen und Gestaltung wider, dass sie einen bestimmten Entwicklungsschritt noch nicht gemacht hätten. Für sie sind altersgerechte Geschichten in einfacherer Sprache motivierend. Diese können sie müheloser lesen als andere Literatur für ihre Altersgruppe. Trotzdem entsprechen Themen, Inhalte und Gestaltung ihren Interessen und ihrer Lebenswelt. Auch in der Wahl des Mediums lohnt es sich, gerade leseungewohnten Kindern und Jugendlichen entgegenzukommen. Zum Thema "Digitales Lesen" spricht die Stiftung Lesen ebenfalls Empfehlungen aus: https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/digitales/ Vorlesen und Selbstlesen Doch wie lassen sich leseungewohnte oder -unwillige Schülerinnen und Schüler motivieren, zu Hause ein Buch, ein Tablet oder das Handy in die Hand zu nehmen und selbständig zu lesen? Jüngere Kinder lieben es normalerweise, wenn ihnen vorgelesen wird. Eine Vorleserunde im Online-Unterricht, bei der sie selbst in ihren Büchern mitlesen, kann ihnen als Einstieg dienen, einen Zugang zum Inhalt des Textes zu finden. Die Lehrkraft kann dann an der spannendsten Stelle aufhören und die Kinder auffordern, die Geschichte selbst zu Ende zu lesen. Am besten funktioniert das, wenn direkt nach der Vorleserunde Zeit dafür ist, sodass die Schülerinnen und Schüler die Spannung, die durch die Geschichte entstanden ist, möglichst zeitnah auflösen können. So stellt die Lehrkraft Verbindlichkeit her: Es wird normal, Geschichten selbst zu Ende zu lesen, weil die Schülerinnen und Schüler wissen möchten, wie sie ausgehen. Die Zeitspanne zwischen Vorlesen und Selbstlesen kann dabei im Laufe des Schuljahres verlängert werden. Wichtig ist, dass der aufgegebene Abschnitt die Schülerinnen und Schüler mengenmäßig nicht überfordert. Die Inhalte der Lektüre werden in der nächsten Unterrichtseinheit besprochen. Partner-Hausaufgaben Viele Kinder und Jugendliche, die nicht gern lesen, fühlen sich beim Lesen allein überfordert. Es kann ihnen helfen, wenn sie soziale Ansprache erhalten. Während für jüngere Kinder das Vorlesen durch die Lehrkraft einen solchen Impuls setzen kann, kann Jugendlichen das gemeinsame Lesen mit Mitschülerinnen oder Mitschülern helfen. Um das gemeinsame Lesen einzuführen, plant die Lehrkraft zunächst einige Einheiten während des Unterrichts. Sie ordnet die Schülerinnen und Schüler über die Lernplattform paarweise in Kleingruppen zu und gibt eine bestimmte Form des gemeinsamen Lesens vor, die in der Folgezeit so beibehalten wird. Eine Möglichkeit stellt das paarweise Lesen dar: Eine Person liest einen Absatz vor. Die andere Person hört zu und gibt das Gehörte in eigenen Worten wieder. Die erste Person gleicht die Wiedergabe mit ihrem eigenen Textverständnis ab. Dann liest die zweite Person den nächsten Absatz und so weiter. Über die Aufteilung des Lesestoffs und den auditiven Input fühlen sich viele Schülerinnen und Schüler entlastet. Sie trainieren das sinnentnehmende Lesen und haben die Möglichkeit, ihr Verständnis regelmäßig abzugleichen. Gleichzeitig üben sie das Vorlesen, ohne dabei vor der ganzen Klasse lesen zu müssen. Der Lernfortschritt, der über diese Methode erreicht werden kann, motiviert die Schülerinnen und Schüler häufig. Ist das Modell im Unterricht erprobt und etabliert, kann es auch für die Hausaufgabe und für die Leseförderung eingesetzt werden: Die Jugendlichen verabreden sich online paarweise zum Lesen, dann präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Partnerarbeit in der nächsten Unterrichtseinheit. Videos aufnehmen Im Online-Unterricht können Formate genutzt werden, die im Präsenz-Unterricht teilweise deutlich umständlicher umzusetzen wären. Zum Beispiel lassen sich Videos der Kinder und Jugendlichen leicht über die gemeinsame Lernplattform zeigen. Auf diese Weise lassen sich gemeinsame Vorleseprojekte realisieren. Die Lehrkraft teilt einen Lesetext gleichmäßig auf die Schülerinnen und Schüler auf, sodass Textteile mit einem altersgerechten Umfang entstehen. Ist der Text eigentlich länger, kann die Lehrkraft selbst Textteile übernehmen oder einige Schülerinnen und Schüler bearbeiten mehrere Texte. Die Kinder oder Jugendlichen üben, ihre Texte zu Hause vorzulesen. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie den Text flüssig lesen können, machen sie eine Videoaufnahme von sich. Die Lehrkraft macht sie darauf aufmerksam, dass sie auch mehrere Aufnahmen machen und dann die beste auswählen können. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt reichen alle Schülerinnen und Schüler ihre Videos ein. Die Lehrkraft schneidet sie zusammen oder spielt sie in der dafür eingeplanten Unterrichtseinheit nacheinander ab. Die Schülerinnen und Schüler hören nun die ganze Geschichte, vorgelesen von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Im Anschluss können Verständnisfragen besprochen und inhaltliche Aufgaben bearbeitet werden. Fazit Um leseungewohnte Schülerinnen und Schüler zum Lesen zu bewegen, hilft es einerseits, Texte sorgfältig und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechend auszuwählen. Eine weitere Hilfe stellt die soziale Einbindung dar: Häufig fühlen sich Kinder und Jugendliche, die wenig lesen, mit einem Text allein überfordert. Durch wechselnde Sozialformen wird das Lesen einfacher. Dabei bieten digitale Unterrichtsformate ganz eigene und vielfältige Möglichkeiten.
-
Deutsch / Kommunikation / Lesen & Schreiben
-
Sekundarstufe I