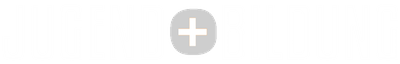Die Debatte um die Lektüre des Köppen-Romans "Tauben im Gras"
Unterrichtseinheit
5,99 €
In dieser Unterrichtseinheit soll eine Positionierung der Lernenden in der Debatte ermöglicht werden, indem sie "verfachlicht" und damit fundiert wird. Ausgegangen wird dabei von der notwendigen Information über die Debatte, über ihre Streitpunkte, ihre Kontroversität, die bei den Schülerinnen und Schülern (Vor-)Urteile entstehen lassen wird. Aus diesen (Vor-)Urteilen sollen Fragen entstehen – an den Text, an den Kontext, an fremde Positionen, die die Schülerinnen und Schüler ins Nachforschen und -denken und letztlich zu einem Befragen ihres (Vor-)Urteils bewegen sollen. Dazu muss – das ist Kern der Überlegungen – auch der Text zu Wort kommen und mithilfe fachlichen Instrumentariums befragt werden. Die Materialien zeigen ausgehend von der aktuellen Debatte um Köppens Roman "Tauben im Gras", dass Literatur aus guten Gründen als Zumutung empfunden werden kann. Sie sollen am Beispiel dieses Romans die Auseinandersetzung mit der Frage anregen, ob aus solchen Zumutungen nicht Erkenntnisse zu gewinnen sind, deren Voraussetzung geradezu die Zumutung ist. Dazu nehmen die Schülerinnen und Schüler zunächst die von einer Lehrerin und großen Teilen der Öffentlichkeit empfundene Zumutung des Romans zur Kenntnis (M1), lernen in Grundzügen den Kontext, in dem sie stattfindet, kennen (M2), bevor sie dann – für die Problematik sensibilisiert – Kontakt mit dem Text, der zur Debatte steht, machen (M3). Dieser Kontakt soll zugleich sensibilisiert und dennoch (im besten Sinne) unbedarft vonstatten gehen, was ein gewisser Widerspruch ist, der unter der gegebenen übergeordneten thematischen Fragestellung zwar nicht aufzulösen ist, aber durch das von den Autorinnen vorgeschlagene literarische Gespräch ein der Sache und Frage angemessenes Ventil finden will. So sollen die Schülerinnen und Schüler zu einer ersten vorläufigen Positionierung in der Angelegenheit kommen, die inhaltlich schwer vorauszusehen ist (vergleiche didaktisch-methodischer Kommentar). Anschließend lernen die Schülerinnen und Schüler kontroverse Reaktionen (M4) auf die Forderung der Lehrerin (M1), den Roman Schülerinnen und Schülern nicht zuzumuten, kennen, die sie veranlassen sollen, ihre Positionierung zu überdenken. Auch hier ist schwer voraussehbar, in welche Richtung sich Positionen festigen oder verschieben. Entscheidend scheint, dass sich der Horizont der Lernenden durch die didaktische Steuerung in der Frage kontinuierlich erweitert. Es handelt sich bei M4 um Kommentare von Autorinnen und Autoren der FAZ, TAZ und der SÜDDEUTSCHEN; ihre Erschließung wird durch entsprechende Aufgaben gesteuert (M4), durch ihre Diskussion werden die Kommentare gesichert, reflektiert und eingeordnet/eingeschätzt. M5 schließlich führt die Schülerinnen und Schüler zurück in den Text: Textanalytisch sollen die Schülerinnen und Schüler nun zu belegen versuchen, dass sie in ihrem ersten Eindruck (M3) richtig liegen – oder aber auch falsch (vergleiche auch didaktisch-methodischer Kommentar); die Schlüssigkeit der (neu?) gewonnenen Positionen wird in M6 und M7 (optional) erneut einer möglichen kontroversen Debatte unterzogen, bevor sie schließlich in M8 im Format des materialgestützten Schreibens ihre Position als Debattenbeitrag formulieren sollen. Die Relevanz des Themas wird im Fachartikel dieser Veröffentlichung ausführlich dargestellt. Die Schülerinnen und Schüler müssen den Roman Köppens nicht vollständig gelesen haben, allerdings über seinen Inhalt informiert sein (siehe M2). Die Schülerinnen und Schüler sind in recht hohem Maß der Kontroversität des Diskurses ausgesetzt, er ist Thema der vorliegenden Sequenz. Das hat methodische Konsequenzen, denn die Kontroversität des Diskurses, wie er sich als Reaktion auf die Entscheidung der Lehrerin (M1 und M4) entfaltet, muss sich auch im Unterricht entfalten, indem sie erstens nachvollzogen wird und zweitens fortgesetzt wird. Das führt zu einer gewissen analytischen und kommunikativen Schwerpunktsetzung (M3, M4, M5, M7) der vorliegenden Sequenz, das dazu notwendige Unterrichtsgespräch wird jedoch durch methodische Settings wie dem des literarischen Gesprächs oder der Podiumsdiskussion methodisch so variiert, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst stark involviert sind und die Lehrkraft nicht notwendigerweise dominant leitet. Wo es sich im Zusammenhang mit dem Primärtext anbietet, wurde ein handlungsorientierter Zugang gewählt, der das Potential hat, dem Gelesenen Ausdruck zu geben und zugleich interpretierend ausgewertet zu werden. Die hohen kommunikativen und diskursiven Anteile haben zugleich (binnen) differenzierenden Charakter, denn sie sind auf Gesprächsanteile der unterschiedlichsten Art förmlich angewiesen, wenn sie sich denn konstruktiv weiterentwickeln wollen. Die Lehrkraft muss das möglichst vermitteln, sollte sich ein Gespräch unter einigen wenigen Schülerinnen und Schülern nur abzeichnen; andere methodische Entscheidungen erlauben es der Lehrkraft aufgrund der intensiven "stillen" Vorarbeit und der kooperativen Arbeitsformen , die Beteiligung auch zurückhaltender Schülerinnen und Schüler einzufordern, andere wiederum, wie zum Beispiel das literarische Gespräch, erfordern mindestens in der 1. Runde ohnehin die Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler. Die häufig ermöglichte bilanzierende und/oder positionierende Verschriftlichung der gewonnen Erkenntnisse soll darüber hinaus dem Kompetenzbereich Schreiben Rechnung tragen und hat so auch das Potential des kompetenzorientierten Vorbereitens auf Prüfungsformate insbesondere der Sek II (materialgestütztes Argumentieren, Stellung nehmen…). Fachkompetenz Die Schülerinnen und Schüler können eigenständig ein Textverständnis formulieren, in das sie persönliche Leseerfahrungen und alternative Lesarten des Textes einbeziehen, und auf der Basis eigener Analyseergebnisse begründen. (TM2) die in literarischen Werken enthaltenen Herausforderungen und Fremdheitserfahrungen kritisch zu eigenen Wertvorstellungen, Welt- und Selbstkonzeption in Beziehung setzen. (TM9) anspruchsvolle Aufgabenstellungen in konkrete Schreibziele und Schreibpläne überführen und komplexe Texte unter Beachtung von Textkonvention eigenständig oder kooperativ strukturieren. (SCH2) Sozialkompetenz Die Schülerinnen und Schüler verständigen sich, diskutieren und kooperieren rücksichtsvoll und im Team und tragen Konflikte aus. sind bereit andere Perspektiven einzunehmen und zu akzeptieren. sind bereit, Irritationen und Dissonanzen auszuhalten und sachorientiert zu verhandeln.
-
Deutsch / Kommunikation / Lesen & Schreiben
-
Sekundarstufe II